zusammen mit Alexander Richter und Michael Kammertöns
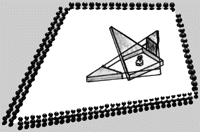
Die Ziele
Das Denkmal soll einerseits eine Stätte der Trauer und der Reflexion über die 6 Millionen ermordeten europäischen Juden sein, andererseits ist es der Versuch, über Betroffenheit und Trauer hinaus eine positive Wendung zur Gegenwart und Zukunft zu ermöglichen.
Es soll im einzelnen:
das Nachdenken über die Dimension des Verbrechens unterstützen,
* eine Auseinandersetzung mit diesem Verbrechen fördern,
* ein Hinausgehen über Trauer und Betroffenheit eröffnen,
* die Erkenntnis des Weiterbestehens jüdischen Lebens in Europa vermitteln,
* die Beschäftigung mit den negativen Folgen nationalistischen Denkens vorantreiben,
* den Willen stärken, künftig gegen Antisemitismus etwas zu unternehmen,
* eine Möglichkeit bieten, vor Ort einen Erfahrungsaustausch zwischen den Nachkommen der Opfer und der Täter über das Wahrnehmen, das Nachdenken und das Verarbeiten der Denkmalsstätte durchzuführen,
* die Annäherung zwischen den Nachkommen der Opfer und der Täter voranbringen,
* versuchen, das Trennende zwischen den Nachkommen der Opfer und der Täter zu überwinden.
Die Mittel
Ein verfremdeter Davidstern ist die äußere Form der Denkmalsstätte. Er setzt sich aus zwei Dreiecken zusammen.
Das niedere Dreieck spiegelt Entwicklung und Verlauf der Vernichtung jüdischen Lebens durch die Nationalsozialisten wieder.
Die Verkeilung der beiden Dreiecke soll das Eindringen des Nationalsozialismus in das Leben der Juden in Europa und die Vernichtung von 6 Millionen Juden wiedergeben. Dadurch, daß das Dreieck der Vernichtung das Dreieck des jüdischen Lebens wie ein Keil durchsstoßen hat, hat es das Dreieck des jüdischen Lebens sowohl verbogen als auch den Davidstern insgesamt verfremdet.
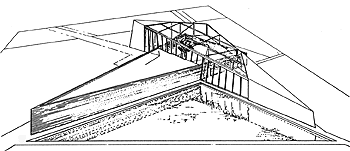
Die unterschiedliche Bedeutung der beiden Dreiecke wird betont:
* durch die jeweils verwendeten Baustoffe, alte Ziegel für das niedere, Beton und Glas für das höhere Dreieck,
* indem das Dreieck des jüdischen Lebens über dem Dreieck der Vernichtung steht, und somit das "Überwinden" der national-sozialistischen Vernichtung verdeutlicht,
* durch die Glaskonstruktion im Mittelteil des Dreiecks des jüdischen Lebens, die den Blick sowohl auf die Vergangenheit (Dreieck der Vernichtung) als auch auf die Zukunft (Olivenbaum des jüdischen Lebens) freigibt,
* durch die konstante Höhe des Dreiecks der Vernichtung gegenüber dem Ansteigen des Dreiecks des jüdischen Lebens,
* durch die fensterlosen Ziegelmauern des Dreiecks der Vernichtung und
* dadurch, daß bei Nacht das Dreieck des jüdischen Lebens durch die Innenbeleuchtung und Glaswände stark gegenüber dem (dunkelen) Dreieck der Vernichtung hervortritt.
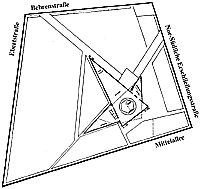
Die Ecken des Denkmals zeigen auf Orte bzw. Ereignisse der national-sozialistischen Vernichtungspolitik und auf Orte des jüdischen Lebens im heutigen Berlin.
Die Ausrichtung des Dreiecks der Vernichtung
1. Die nördliche Ausrichtung des Dreiecks verweist auf das Brandenburger Tor und erinnert an den Aufmarsch der Nationalsozialisten am Abend des 30.1.1933, nachdem Hitler mit der Regierungsbildung beauftragt worden war.
2. Die östliche Ausrichtung verweist auf den Opernplatz als Ort der nationalsozialistischen Bücherverbrennung am 10.5.1933 (Heinrich Heine: "Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen").
3. Die südlichen Ausrichtungen verweisen auf das Gelände der Reichskanzlei in der Voßstraße, auf den Sitz von SS und SA an der Prinz-Albrecht-Str. und auf die Wannsee Villa, wo am 20.1.1942 einen Konferenz über die Durchführung des Massenmords an den europäischen Juden stattfand.
Die drei Daten, 30.1.1933, 10.5.1933 und 20.1.1942 sollen im Außenbereich an den entsprechenden Ecken des Dreiecks der Vernichtung im Bodenbereich angebracht werden.
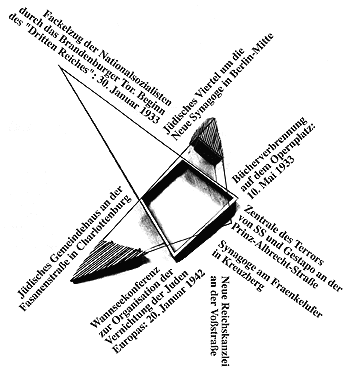
Die Ausrichtung des Dreiecks jüdischen Lebens
Dieses Dreiecks soll das jüdische Leben in Europa wiederspiegeln. Gleichzeitig zeigen die jeweiligen Spitzen in Richtung auf Stätten des heutigen jüdischen Lebens in Berlin.
1. Die nordöstliche Ausrichtung verweist auf die Oranienburgerstraße und das Scheunenviertel als Orte vergangenen und gegenwärtigen jüdischen Lebens im Bezirk Mitte.
2. Die südöstliche Ausrichtung verweist auf die Synagoge am Fraenkelufer in Kreuzberg.
3. Die südwestliche Ausrichtung verweist auf das Jüdische Gemeindezentrum in der Fasanenstraße in Charlottenburg.
Das Ausmaß des Massenmordes an den 6 Millionen europäischen Juden soll durch ihn versinnbildlicht werden. Die Verwendung von 6 Millionen Steinen steht in bezug zu jüdischen Traditionen.
1. Beim Friedhofsbesuch bringen Juden Steine zu den Gräbern ihrer Freunde bzw. Verwandten und
legen sie auf den Grabstein, um zu sagen "Es war jemand hier, der an dich gedacht hat."
2. Nach jüdischer Auffassung sollte, wenn Tote keine Gräber haben, wenigstens durch ein Stein an
sie erinnert werden.
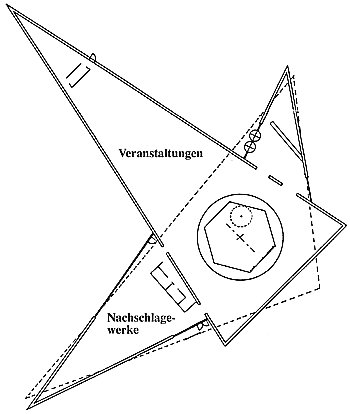
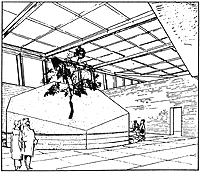
Mit diesem Baum soll eine positive Wendung zur Gegenwart und Zukunft erreicht werden. Er soll bekunden,
1. daß es nicht gelang und nicht gelingen wird, jüdisches Leben in Europa zu vernichten, und
2. daß das jüdische Leben in Europa eine Gegenwart und eine Zukunft hat.
"Sie waren ein Teil von uns -
Sie sind ein Teil von uns."
Er soll in seiner Doppeldeutigkeit sowohl gedenken als auch zum Nachdenken auffordern. Zugleich hat er für jüdische Besucher eine andere Bedeutung als für nichtjüdische.
Die vordere Spitze des Dreiecks des jüdischen Lebens ist der Raum, wo Besucher die Möglichkeit haben anhand von Computern und Nachschlagwerken ein konkretes Opfer zu fixieren, es aus der anonymen Masse der 6 Millionen Ermorderten herauszusuchen. An den Wänden soll ein vollständiger Überblick über die jüdischen Gemeinden in Europa vor 1933 und nach 1945 gegeben werden.
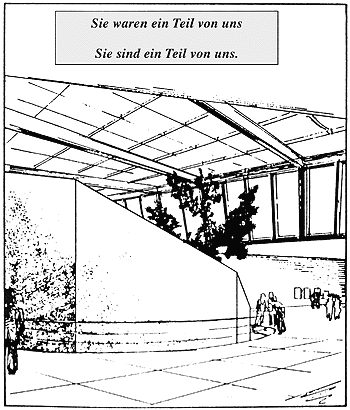
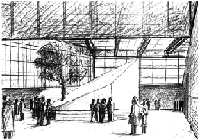
Der Raum soll für Wechselausstellungen als auch für Veranstaltungen, wie zum Beispiel Diskussionen, Gespräche, Filmvorführungen, Vorträge, Konzerte und Ansprachen verwendet werden.